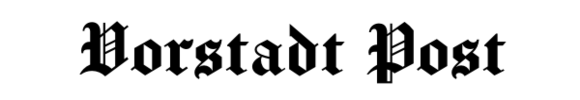Die Einführung der Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Arbeitswelt tiefgreifend: Automatisierung, Assistenz-Systeme und smarte Prozesse dringen in bislang eher menschlich geprägte Tätigkeiten vor. Die zentrale Frage lautet daher: Ist KI eine Chance oder ein Risiko für Beschäftigte? Im Folgenden wird dieser Frage anhand von fünf Perspektiven nachgegangen – mit einem Fazit zum Schluss.
1. Produktivität, Effizienz und neue Möglichkeiten
Ein oft genanntes Argument für den Einsatz von KI ist die Steigerung von Produktivität und Effizienz am Arbeitsplatz. So zeigt eine Studie der PwC, dass 85 % der befragten Berufstätigen angaben, dank KI-Tools Aufgaben schneller erledigen zu können. Darüber hinaus stellte man fest, dass Kreativität gesteigert wurde (83 %) und die Qualität der Arbeitsergebnisse sich verbesserte.
Auch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) sieht Potential: „KI hält Einzug in die Betriebe … Die Beurteilung der Chancen und Risiken für Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie die menschengerechte Umsetzung sind […] zentrale Herausforderungen.“
Kurz gesagt: KI kann repetitive Arbeiten übernehmen, Daten schneller analysieren, Routinen automatisieren – und so Beschäftigten Freiräume für komplexere Tätigkeiten eröffnen.
Chancen in diesem Bereich:
- Entlastung bei monotonen, strukturierten Aufgaben
- Möglichkeit zur Konzentration auf kreative oder strategische Tätigkeiten
- Neue Geschäftsmodelle und Arbeitsformen, die mit KI-Assistenz entstehen
2. Qualifikationsanforderungen und neue Arbeitsprofile
Durch KI verändern sich nicht nur Prozesse, sondern auch die Anforderungen an Beschäftigte. Laut der PwC-Studie „AI Jobs Barometer 2025“ steigen Qualifikationsanforderungen in stark KI-betroffenen Berufen um 66 % schneller als in anderen Bereichen. Zudem sehen die Autoren, dass KI nicht primär Arbeitskräfte verdrängen, sondern sie produktiver machen kann – wenn entsprechende Qualifikationen vorhanden sind.
Das Problem: Nicht alle Beschäftigten oder Unternehmen sind gleich gut vorbereitet. Die Konstanzer Studie zeigt beispielsweise, dass Beschäftigte mit Hochschulabschluss dreimal so häufig KI-Tools nutzen wie solche mit niedrigem Bildungsabschluss.
Es entsteht eine digitale Kluft: Wer nicht über die nötigen Qualifikationen verfügt oder sich nicht weiterbilden kann, läuft Gefahr, abgehängt zu werden.
Chancen:
- Erwerb von neuen, hochwertigen Kompetenzen (z. B. KI-Gestaltung, Datenanalyse, KI-Überwachung)
- Erweiterung des Tätigkeitsfelds über Routine hinaus
Risiken: - Qualifikationsanforderungen steigen, manche Beschäftigte fühlen sich überfordert
- Ungleichheit im Zugang zu Weiterbildung und damit mögliche Benachteiligung
3. Arbeitsplatzsicherheit und Veränderung von Tätigkeiten
Ein zentrales Thema: Wird durch KI Arbeit wegfallen? Laut der Konstanzer Studie sieht fast die Hälfte der Beschäftigten (46 %) gravierende Risiken für den gesamten Arbeitsmarkt durch Automatisierung. Gleichzeitig fürchtet nur etwa jeder fünfte Beschäftigte den Verlust des eigenen Arbeitsplatzes.
Auch die PwC-Umfrage zeigt: 4 von 10 Berufstätigen befürchten, dass ihr Job in zehn Jahren durch KI wegfallen könnte.
Die Forschung zeigt: Nicht zwangsläufig ganze Jobs verschwinden, aber viele Tätigkeiten werden sich verändern – Routineanteile sinken, während kommunikative, kreative, soziale Kompetenzen an Bedeutung gewinnen.
Somit heißt es für Beschäftigte: Anpassungsfähigkeit ist gefragt.
Risiken:
- Tätigkeitsprofile können sich stark verändern
- Angst vor Arbeitsplatzverlust oder Entwertung des eigenen Berufsbildes
Chancen: - Neue Aufgaben beziehungsweise Rollen mit höheren Anforderungen
- Möglichkeit, sich in Zukunftsfelder zu bewegen
4. Mitbestimmung, Transparenz und Arbeitsgestaltung
Ein oft übersehener Aspekt: Wie wird KI in der Arbeitswelt implementiert – und wie stark sind Beschäftigte beteiligt? Laut einem Dokument der IHK wünschen sich 39 % der Beschäftigten sehr stark und 47 % stark, vor einer KI-Einführung mitbestimmt zu werden.
In vielen Unternehmen fehlen jedoch noch klare Richtlinien, Schulungen oder transparente Verfahren im Umgang mit KI. Die PwC-Studie zeigt, dass weniger als die Hälfte der Unternehmen spezifische Vorgaben für KI-Nutzung haben.
Damit ist die menschgerechte Arbeitsgestaltung — z. B. Arbeitsbelastung, Autonomie, Datenschutz — bei KI-Einsatz keineswegs garantiert.
Chancen:
- Beteiligung der Beschäftigten kann Vertrauen schaffen und Integration erleichtern
- Gute Arbeitsgestaltung ermöglicht sinnvolle Kooperation Mensch-KI
Risiken: - Fehlende Transparenz und Beteiligung können zu Misstrauen, Stress oder fehlender Akzeptanz führen
- KI-Überwachung oder erhöhte Arbeitsintensität sind mögliche Nebenwirkungen
5. Ungleichheiten und segmentierte Effekte
KI wirkt nicht gleich in allen Sektoren und Berufsgruppen. Die Konstanzer Studie zeigt, dass im Bereich Büro- und Wissensarbeit etwa 43 % der Beschäftigten positive Effekte durch KI erwarten, in handwerklichen bzw. produktionsnahen Berufen hingegen nur 24 %.
Damit verstärkt KI möglicherweise bestehende Ungleichheiten: Qualifikation, Branche, Betriebsgröße spielen eine Rolle.
Für Beschäftigte in manuellen Tätigkeiten bestehen besondere Risiken, wenn Qualifikation und Weiterbildung weniger vorhanden sind und KI-Support seltener eingesetzt wird.
Chancen:
- In zukunftsfähigen Bereichen hohe Potenziale für Beschäftigte
Risiken: - Beschäftigte in weniger digitalisierten Branchen könnten weiter zurückfallen
- Verteilungsprobleme: Wer profitiert und wer wird zurückgelassen?
Fazit
Die Frage „Chancen oder Risiko?“ lässt sich nicht pauschal mit nur einem der beiden Begriffe beantworten. Vielmehr zeigt sich: KI bietet große Chancen, aber die Risiken sind real und müssen aktiv gestaltet werden.
Zu den wichtigsten Chancen zählen:
- Entlastung von Routinearbeit und Freiraum für komplexere Tätigkeiten
- Produktivitäts- und Qualitätssteigerungen
- Neue Qualifikations- und Tätigkeitsfelder
Zu den zentralen Risiken gehören:
- Qualifikations- und Bildungsanforderungen steigen, Ungleichheiten können sich verstärken
- Veränderung oder Wegfall von Tätigkeiten – mit Unsicherheiten für Beschäftigte
- Mangelnde Mitbestimmung, fehlende Transparenz und mögliche Überlastung
Damit Beschäftigte nicht auf der Strecke bleiben, sind drei zentrale Handlungsfelder entscheidend:
- Weiterbildung und Qualifizierung: Beschäftigte müssen fit gemacht werden für den Umgang mit KI-Werkzeugen, für neue Rollen und komplexere Aufgaben.
- Partizipation und Gestaltung: Prozesse der Einführung von KI müssen transparent sein, Mitarbeitende sollten mitgenommen und beteiligt werden.
- Arbeitsgestaltung und Regulierung: KI-Systeme sollten menschen- und ergonomiegerecht gestaltet sein, mit klaren Richtlinien, Datenschutz und Arbeitszeit- sowie Belastungsgrenzen.
In der Summe gilt: Wenn Unternehmen wie Beschäftigte die Transformation gemeinsam gestalten, kann KI zu einem Motor für bessere Arbeitsbedingungen, spannende Aufgaben und wirtschaftlichen Erfolg werden. Wird sie hingegen nur als technischer Automatismus implementiert, ohne die Menschen mitzunehmen, drohen Ablehnung, Ungleichheiten und soziale Spannungen.
Für Beschäftigte heißt das: Offenheit für Veränderung, Bereitschaft zur Weiterbildung und aktive Mitwirkung sind gute Voraussetzungen. Für Arbeitgeber und Gesellschaft heißt das: Gestaltungskraft, Verantwortung und Teilhabe sind gefragt. Nur so wird KI in der Arbeitswelt zur echten Chance – und nicht primär zum Risiko.